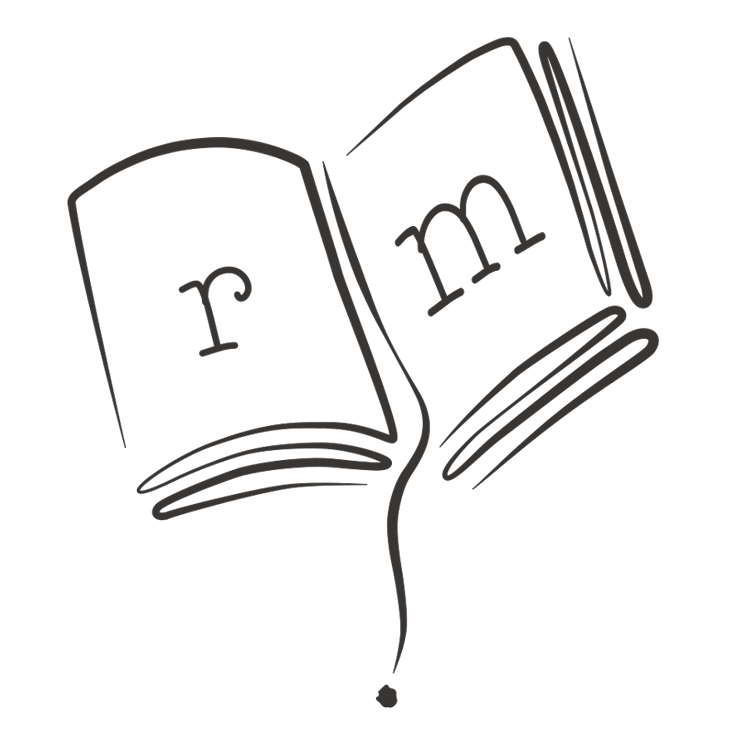So weit der Fluss uns trägt - Shelley Read
Iola, Colorado, Anfang der 1940er Jahre. Victoria, genannt Torie, ist gerade 12 Jahre alt als ihre Mutter bei einem Unfall stirbt. Zur Trauer des Mädchens gesellt sich bald die sichere Gewissheit, keine Verbündete mehr zu haben, in einem Haushalt, nein, in einer Welt voller Männer, unsichtbar werden zu müssen. Viel Zeit und Raum, den Verlust zu beklagen, bleibt der Familie ohnehin nicht; die Jahreszeiten bestimmen den Alltag auf ihrer Pfirsichfarm am Gunnison River, die Natur sichert ihr Einkommen und duldet keinen Aufschub. Über die Liebe, die Leidenschaft und ihre Tücken weiß die junge Frau nichts, stürzt sich mitten hinein als sie Wilson Moon trifft, einen Außenseiter, einen Geächteten ob seiner indigenen Herkunft, und sich Hals über Kopf verliebt. Victorias weitere Leben ist geprägt von dieser innigen Verbindung und der zu ihrer rauen Heimat – wie ein Fluss fließt es unaufhaltsam und findet seinen Weg; ihr Schicksal, tief verwurzelt mit der Erde, dem Land, das es berührt. Ein Kind entsteht und wächst unter erschwerten Bedingungen auf, mitten hinein in eine Gesellschaft voller Vorurteile und Unruhen; der Vietnamkrieg steht bevor, ganze Orte und Landstriche müssen sich dem Wandel der Zeit beugen und weichen. Die Welt verändert sich stetig, während es Victoria gelingt, Haltung und sich eine große innere Stärke zu bewahren.
Shelley Read schlägt einen Bogen über drei Jahrzehnte, erzählt in ihrem Debütroman von Emanzipation und Mutterschaft, von der Verbundenheit der eigenen Seele mit dem Kosmos. Dabei verknüpft sie die Natur eng mit den Figuren, flechtet sie zu einem untrennbaren Zopf, stark inspiriert von ihrer eigenen Vergangenheit. Die Sprache ist sehr blumig, bildhaft und metaphorisch, daran musste ich mich ein wenig gewöhnen und gerade zu Beginn großzügig über manche arg klischeehafte Formulierung hinweglesen. Doch nach kurzer Zeit fand ich mich ganz tief in dieser Geschichte wieder, die mein Herz berührt hat, mein Mutterherz und mein fest verwurzeltes Heimatherz; hat mich doch Bleiben immer mehr gereizt als Gehen.
Aus dem amerikanischen Englisch von Wibke Kuhn.